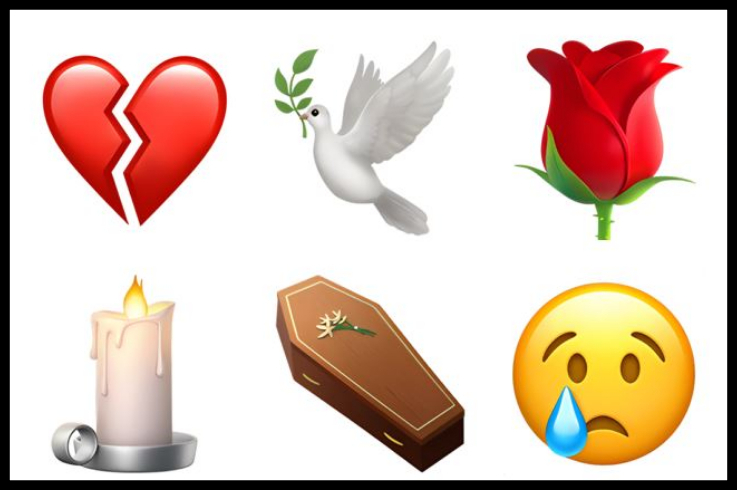Digitale Trauer: «Im Netz fühlt man sich getröstet»
Portrait
Das Forschungsprojekt
Das Forschungsprojekt "Trauerpraktiken im Internet" der Universität Zürich untersucht aus linguistischer Perspektive, wie Menschen ihre Trauer im Internet digital ausdrücken, wie sie Beileidsbekundungen nach dem Verlust eines geliebten Menschen oder einem anderen tragischen Ereignis verbalisieren und wie sich der öffentliche Diskurs über diese Art des Trauerns gestaltet.
Zur Untersuchung dieser Fragen werden zwei Korpora aufgebaut: Korpus 1 enthält Daten aus unterschiedlichen Webquellen (bspw. Online-Gedenkseiten, soziale Netzwerke), Korpus 2 besteht aus Medienberichten über Online-Trauerpraktiken. Die Auswertung der Daten erfolgt mithilfe einer Kombination aus quantitativen und qualitativen Methoden.
Dieses Vorgehen erlaubt es, die Auswirkungen digitaler Trauerpraktiken auf den gesellschaftlichen Trauerdiskurs umfassend zu untersuchen und der Frage nachzugehen, wie sich im Internet neue Formen von Abschieds- und Kondolenzgemeinschaften konstituieren.
Zudem leistet das Projekt einen Beitrag zur Debatte über die Dimensionen des Privaten und Öffentlichen und über den Umgang mit sensiblen Daten im Internet: Individuelle (aber kulturell geprägte und oft stark stereotypisierte) Trauerbekundungen werden mit Fremden geteilt, Bilder von Verstorbenen werden veröffentlicht, persönliche Leidensgeschichten werden zugänglich gemacht. All dies hat Auswirkungen auf unser Verständnis von Privatsphäre. Und das wiederum ist ein brisantes gesellschaftspolitisches Thema.
Zur Untersuchung dieser Fragen werden zwei Korpora aufgebaut: Korpus 1 enthält Daten aus unterschiedlichen Webquellen (bspw. Online-Gedenkseiten, soziale Netzwerke), Korpus 2 besteht aus Medienberichten über Online-Trauerpraktiken. Die Auswertung der Daten erfolgt mithilfe einer Kombination aus quantitativen und qualitativen Methoden.
Dieses Vorgehen erlaubt es, die Auswirkungen digitaler Trauerpraktiken auf den gesellschaftlichen Trauerdiskurs umfassend zu untersuchen und der Frage nachzugehen, wie sich im Internet neue Formen von Abschieds- und Kondolenzgemeinschaften konstituieren.
Zudem leistet das Projekt einen Beitrag zur Debatte über die Dimensionen des Privaten und Öffentlichen und über den Umgang mit sensiblen Daten im Internet: Individuelle (aber kulturell geprägte und oft stark stereotypisierte) Trauerbekundungen werden mit Fremden geteilt, Bilder von Verstorbenen werden veröffentlicht, persönliche Leidensgeschichten werden zugänglich gemacht. All dies hat Auswirkungen auf unser Verständnis von Privatsphäre. Und das wiederum ist ein brisantes gesellschaftspolitisches Thema.
Links zum Thema
Dokumente zum Thema
20. Mai 2024
Immer mehr Trauernde richten Gedenkseiten für ihre Verstorbenen ein. Oder sie treffen sich in virtuellen Trauergruppen. Doch wer kontrolliert, was veröffentlicht werden darf? Und wer regelt den digitalen Nachlass? Ein Gespräch mit Karina Frick, Co-Leiterin des Forschungsprojekts «Trauerpraktiken im Internet» im Forschungsschwerpunkt «Digital Religion(s)» an der Universität Zürich.
Die Digitalisierung bestimmt grosse Bereiche unseres Alltags und inzwischen auch unseren Umgang mit Tod und Trauer. Woran zeigt sich das?
Karina Frick: Das zeigt sich an der heutigen Präsenz der digitalen Plattformen im Internet, welche sich mit Tod und Trauer befassen. Anfangs gab es auf Sozialen Medien wie Facebook oder Instagram vorwiegend «everyday communication», wo wir uns über belanglose Alltagsthemen austauschten. Das hat sich in den letzten Jahren verändert. Ich glaube, die Pandemie hat diesen Wandel wesentlich beschleunigt. Auf einmal gab es Online-Abschiedsfeiern. Oder Direktübertragungen aus dem Spital wurden genutzt, um Abschied von sterbenden Angehörigen zu nehmen. Tod und Trauer sind in der digitalen Welt angekommen. Kürzlich hatte jemand gar eine Todesanzeige in seinem WhatsApp-Status.
Es gibt Gedenkseiten für Verstorbene. Virtuelle Friedhöfe. Man kann digital eine Kerze anzünden. Was für andere Praktiken sind derzeit im Trend?
Ein aktueller Trend sind Trauer-Accounts, beispielsweise auf Instagram. Dort erzählen Menschen ihre persönliche Verlust-Geschichte. Diese wird dann zum Hauptinhalt des Accounts gemacht mit der Idee, anderen, die Ähnliches durchlebt haben, zu helfen. Da werden ganz viele Stories gepostet, oft aber auch detaillierte Erzählungen, wie die betrauerte Person verstorben ist. Das macht man heute auf der persönlichen Seite, die man bereits vor dem Todesfall bewirtschaftete, und man nutzt weniger oft vorgefertigte Gedenkseiten.
Die Hinterbliebenen erzählen die eigene Geschichte. Sind Instagram und Facebook die neuen Tagebücher?
Vielleicht. Diese Social-Media-Plattformen haben aber gegenüber dem Tagebuch einen grossen Vorteil. Sie haben ein Publikum und ermöglichen Interaktionen, was beim Tagebuch nicht der Fall ist. Damit generieren die Leute einen Mehrwert, denn sie fühlen sich gesehen in einer Community, wo Menschen Vergleichbares erlebt haben und Trost spenden können oder Mitleid empfinden. Man will nicht nur über den Verstorbenen sprechen und schreiben, sondern gerade auch darüber, wie es einem selbst ergeht. Wie man mit der Trauer umgeht. Das hat sich auch in den traditionellen Todesanzeigen in diese Richtung entwickelt. Während man früher in einer Todesanzeige den Tod vermeldet hat, sind es inzwischen Traueranzeigen. Das zentrale Thema ist, dass wir trauern, dass wir den Verstorbenen vermissen – und nicht die Tatsache, dass er gestorben ist.
Und so bringt das Internet Leute als Trauergemeinschaft zusammen, welche sich vielleicht nicht einmal kennen.
Ja, denn hier im Netz fühlt man sich getröstet. Man kann sich mit Menschen verbinden, die man nicht kennt, aber die in einer ähnlichen Lebenssituation sind. Da werden Grenzen aufgehoben, beispielsweise die geografischen. Wenn ich zum Beispiel ein Kind verloren habe, dann ist das etwas, das in meinem näheren Umfeld nicht unbedingt auch anderen passiert ist. In der Online-Community aber schon. Das ist ein wesentliche Punkt von Online-Trauerpraktiken. Man kann sich ganz einfach via Hashtags verlinken. Und das Angebot ist zeitlich unbegrenzt. Während sich die reale Trauergruppe der örtlichen Kirchgemeinde vielleicht einmal im Monat trifft, kann man im Internet jeden Tag etwas posten, wenn man will. Und man kann das über 20 oder 30 Jahre machen, wenn man möchte – es gibt also auch zeitlich keine Grenzen. Ob das psychologisch sinnvoll ist, dazu kann ich als Linguistin nicht viel sagen, aber es gibt es natürlich Fachleute, die feststellen, dass wir irgendwann etwas Abstand von der Trauer gewinnen sollten. Dies ist auf diese Art und Weise mitunter schwieriger.
Es gibt nicht nur die Trauer um einen nahestehenden Verstorbenen. Es gibt auch die Trauer um eine Persönlichkeit. Was läuft da ab?
Das läuft im Grunde ähnlich. Man spricht in diesem Fall von parasozialen Beziehungen, beispielsweise wenn jemand eine Fan-Beziehung pflegte zu einem Star wie Michel Jackson. Die Trauernden waren dem Star physisch zwar nicht nah, wie dies vielleicht bei einem Familienmitglied der Fall ist. Aber die verstorbene Person hatte einen wichtigen Status in ihrem Leben, man fühlte sich ihr nah. Sie hat einen vielleicht durch die Kindheit begleitet, durch die Teenager-Zeit oder weckt Erinnerungen an die eigene Hochzeit – von daher kann dieses Trauergefühl sehr ähnlich sein, wie wenn wir jemanden im realen Leben gekannt haben. Die Beziehung ist zwar meistens nur einseitig, aber aus Sicht der trauerenden Person dennoch stark. Interessant ist, dass man in den Sozialen Medien oft beobachten kann, dass die Menschen ihre Trauer legitimieren wollen. Beispielsweise, dass sie schon seit Jahren Fan sind – und deshalb trauern dürfen. Das sagt sehr viel über unsere Vorstellung aus, unter welchen Umständen man überhaupt das Recht hat zu trauern. Da gibt es Normen in unserer Gesellschaft. Wenn jemand Nahestehendes stirbt, dann wird erwartet, dass wir traurig sind. Beim Onkel dritten Grades ist das nicht ganz so zwingend und beim Arbeitskollegen ist es nochmals anders. Die Vorstellung, wann man wie stark trauern darf, ist in den Köpfen drin.
Und dann gibt es noch die Trauer über ein Ereignis. Welche Mechanismen spielen da?
Das erste Ereignis, das im Internet in grossem Stil betrauert wurde, war wohl Charlie Hebdo, der Anschlag 2015 auf die Redaktion der Pariser Satirezeitung. In solchen Fällen geht es meiner Ansicht nach nicht nur um Trauer, sondern auch um Angst. Angst, dass so etwas möglich ist, Angst, dass einem selbst auch so etwas passieren könnte. Im Grunde kann man aber Ähnliches beobachten wie bei der Fan-Trauerkommunikation, also dass sich ganz viele Leute auf den verschiedensten Plattformen äussern. Oftmals sind die Äusserungen musterhaft und ähnlich. So etwa wie RIP, «rest in pace». Oder bei Charlie Hebdo «Je suis charlie». Das ist übrigens ein schönes Beispiel für eine sprachliche Formel, die aus einem konkreten Ereignis hervorging. Beim Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Deutschland hiess es dann «Ich bin Berlin». Und es folgten bei weiteren Ereignissen viele «Ich bin …». Auf der emotionalen Ebene hat diese Art von Trauer die Facette der Solidarität mit den Opfern und den Hinterbliebenen. Wieder ist dieses vernetzende Momentum im Zentrum. Man ist nicht allein mit dieser Angst, mit dieser Trauer.
Viele Tweets beinhalten religiöse Anspielungen, etwa betende Hände, ein Emoji mit Heiligenschein, ein Kreuz. Welche Rolle spielt in dieser digitalen Welt die Religion tatsächlich?
Ich glaube, sie spielt schon eine Rolle. Die Religion ist in unserer westlichen Welt fest verankert als Sinnangebot bei todesbezogenen Verlusterfahrungen. Das hat sich eingeprägt, und sich ganz davon zu lösen, fällt vielen schwer. Auch wenn sie im Alltag gar nicht religiös aktiv sind. Die verwendeten religiösen Symbole oder beispielsweise das RIP sind zwar verblasst in in ihrer religiösen Bedeutung, aber sie bieten einen tröstlichen, bekannten Rahmen und geben irgendwie Sicherheit. Um das kurz zu illustrieren: Vor zwei Wochen ist in meiner Familie jemand gestorben und wir haben keine Beerdigung gemacht, sondern einfach die Asche verstreut. Das ist etwas, wozu man sich noch immer ganz bewusst entscheiden muss, wenn man das will. Und so ein Entscheid löst auch heute noch kritische Stimmen aus. Das zeigt, dass der Tod noch immer mit tief verankerten religiösen Ritualen verknüpft ist. Auf den Sozialen Medien ist dies zwar nur auf einer abstrakten Ebene erkennbar, aber ganz loslösen kann man den religiösen Aspekt nicht.
Mit digitalen Trauerbekundungen werden auch sensible Daten aufs Internet geladen, wie etwa Bilder des Verstorbenen. Oder die persönliche Leidensgeschichte wird öffentlich gemacht, ohne dass der Betroffene seine Einwilligung gegeben hat. Müssten da rechtliche Schranken gesetzt werden?
Das ist eine wichtige und gleichzeitig schwierige Frage. Ich habe kürzlich zusammen mit einer Kollegin ein Heft zum Thema (Online-)Trauerpraktiken herausgegeben, worin sich auch ein Jurist geäussert hat. Die Lage ist in vielerlei Hinsicht unklar. Es gibt kaum Leitlinien. In der Schweiz ist es so, dass das Persönlichkeitsrecht mit dem Tod erlischt. Erstmal ist also eine digitale Verarbeitung einer ganz persönlichen Lebens- und Sterbegeschichte nichts Illegales. Ethisch gesehen ist das aber eine andere Sache. Man muss sich fragen, ob das, was im Internet publiziert wird, im Sinne der Verstorbenen ist. Vielleicht steht heute aber das Bedürfnis des Trauernden vermehrt im Vordergrund und nicht mehr die Wünsche des Verstorbenen.
Gibt es Massnahmen, die jeder von uns bereits zu Lebzeiten ergreifen kann?
Man muss sehr deutlich äussern, was man sich wünscht. Es gibt beispielsweise eine so genannte «Postmortale Vollmacht». Darin kann man unter anderem festlegen, was mit den eigenen Profilen in den Sozialen Netzwerken geschehen soll. Und es gibt offenbar auch die Möglichkeit, den Hinterbliebenen Auflagen zu machen, was sie tun dürfen mit dem Digitalen Nachlass und was nicht. Laut Rechtsexperten ist das Verfassen einer solchen Auflage aber äusserst komplex und nicht einfach umzusetzen. Am besten ist es deshalb erstmal, seine Wünsche den Angehörigen ganz deutlich mitzuteilen – und darauf zu hoffen, dass sie dann auch so umgesetzt werden.
Schauen wir in die Zukunft. Künstliche Intelligenz ist in aller Munde. Bereits werden Verstorbene virtuell wieder zum Leben erweckt.
Bis zu einem gewissen Grad kann es vielleicht helfen, Dinge abzuschliessen. Die Frage ist, ob das auf die Zeit hinaus sinnvoll ist, um den Trauerprozess voranzubringen. In unseren Untersuchungen zeigte sich ein riesiges Bedürfnis, den «Dialog» mit dem Verstorbenen aufrechtzuerhalten. Sowohl in den Sozialen Medien als auch auf den Gedenkseiten werden die Verstorbenen immer wieder direkt angesprochen. Es werden Briefe an die Verstorbenen geschrieben und eigene Alltagssorgen erzählt. Die künstlichen Plattformen gaukeln einem vor, dass man weiterhin mit der verstorbenen Liebsten sprechen kann – auch wenn man keine Antwort bekommt. Das normale Leben wieder aufzunehmen wird, wenn dieser Zustand länger dauert, schwierig. Vielleicht kennen Sie die britisches Netflix-Serie «black mirror» In einer Episode stirbt der Partner und die Hinterbliebene bekommt Mails und Telefonanrufe aufgrund der vielen Daten, die er im Netz hinterlassen hat. Und irgendwann wird dann ein Roboter geliefert, der so spricht und aussieht wie der Verstorbene. Die Geschichte geht nicht gut aus …
Wird sich KI im Trauerprozess trotzdem etablieren?
Ich weiss es nicht, wie in vielen Bereichen hat KI Potential und Gefahren – auch wenn es um Trauer geht. Wir können uns vor KI zwar nicht verschliessen, aber die Frage ist, wie wir mit ihr umgehen. Wollen wir wirklich alle mit Hologrammen sprechen? Alltagstauglich wird das vermutlich erstmal nicht sein.
Karina Frick: Das zeigt sich an der heutigen Präsenz der digitalen Plattformen im Internet, welche sich mit Tod und Trauer befassen. Anfangs gab es auf Sozialen Medien wie Facebook oder Instagram vorwiegend «everyday communication», wo wir uns über belanglose Alltagsthemen austauschten. Das hat sich in den letzten Jahren verändert. Ich glaube, die Pandemie hat diesen Wandel wesentlich beschleunigt. Auf einmal gab es Online-Abschiedsfeiern. Oder Direktübertragungen aus dem Spital wurden genutzt, um Abschied von sterbenden Angehörigen zu nehmen. Tod und Trauer sind in der digitalen Welt angekommen. Kürzlich hatte jemand gar eine Todesanzeige in seinem WhatsApp-Status.
Es gibt Gedenkseiten für Verstorbene. Virtuelle Friedhöfe. Man kann digital eine Kerze anzünden. Was für andere Praktiken sind derzeit im Trend?
Ein aktueller Trend sind Trauer-Accounts, beispielsweise auf Instagram. Dort erzählen Menschen ihre persönliche Verlust-Geschichte. Diese wird dann zum Hauptinhalt des Accounts gemacht mit der Idee, anderen, die Ähnliches durchlebt haben, zu helfen. Da werden ganz viele Stories gepostet, oft aber auch detaillierte Erzählungen, wie die betrauerte Person verstorben ist. Das macht man heute auf der persönlichen Seite, die man bereits vor dem Todesfall bewirtschaftete, und man nutzt weniger oft vorgefertigte Gedenkseiten.
Die Hinterbliebenen erzählen die eigene Geschichte. Sind Instagram und Facebook die neuen Tagebücher?
Vielleicht. Diese Social-Media-Plattformen haben aber gegenüber dem Tagebuch einen grossen Vorteil. Sie haben ein Publikum und ermöglichen Interaktionen, was beim Tagebuch nicht der Fall ist. Damit generieren die Leute einen Mehrwert, denn sie fühlen sich gesehen in einer Community, wo Menschen Vergleichbares erlebt haben und Trost spenden können oder Mitleid empfinden. Man will nicht nur über den Verstorbenen sprechen und schreiben, sondern gerade auch darüber, wie es einem selbst ergeht. Wie man mit der Trauer umgeht. Das hat sich auch in den traditionellen Todesanzeigen in diese Richtung entwickelt. Während man früher in einer Todesanzeige den Tod vermeldet hat, sind es inzwischen Traueranzeigen. Das zentrale Thema ist, dass wir trauern, dass wir den Verstorbenen vermissen – und nicht die Tatsache, dass er gestorben ist.
Und so bringt das Internet Leute als Trauergemeinschaft zusammen, welche sich vielleicht nicht einmal kennen.
Ja, denn hier im Netz fühlt man sich getröstet. Man kann sich mit Menschen verbinden, die man nicht kennt, aber die in einer ähnlichen Lebenssituation sind. Da werden Grenzen aufgehoben, beispielsweise die geografischen. Wenn ich zum Beispiel ein Kind verloren habe, dann ist das etwas, das in meinem näheren Umfeld nicht unbedingt auch anderen passiert ist. In der Online-Community aber schon. Das ist ein wesentliche Punkt von Online-Trauerpraktiken. Man kann sich ganz einfach via Hashtags verlinken. Und das Angebot ist zeitlich unbegrenzt. Während sich die reale Trauergruppe der örtlichen Kirchgemeinde vielleicht einmal im Monat trifft, kann man im Internet jeden Tag etwas posten, wenn man will. Und man kann das über 20 oder 30 Jahre machen, wenn man möchte – es gibt also auch zeitlich keine Grenzen. Ob das psychologisch sinnvoll ist, dazu kann ich als Linguistin nicht viel sagen, aber es gibt es natürlich Fachleute, die feststellen, dass wir irgendwann etwas Abstand von der Trauer gewinnen sollten. Dies ist auf diese Art und Weise mitunter schwieriger.
Es gibt nicht nur die Trauer um einen nahestehenden Verstorbenen. Es gibt auch die Trauer um eine Persönlichkeit. Was läuft da ab?
Das läuft im Grunde ähnlich. Man spricht in diesem Fall von parasozialen Beziehungen, beispielsweise wenn jemand eine Fan-Beziehung pflegte zu einem Star wie Michel Jackson. Die Trauernden waren dem Star physisch zwar nicht nah, wie dies vielleicht bei einem Familienmitglied der Fall ist. Aber die verstorbene Person hatte einen wichtigen Status in ihrem Leben, man fühlte sich ihr nah. Sie hat einen vielleicht durch die Kindheit begleitet, durch die Teenager-Zeit oder weckt Erinnerungen an die eigene Hochzeit – von daher kann dieses Trauergefühl sehr ähnlich sein, wie wenn wir jemanden im realen Leben gekannt haben. Die Beziehung ist zwar meistens nur einseitig, aber aus Sicht der trauerenden Person dennoch stark. Interessant ist, dass man in den Sozialen Medien oft beobachten kann, dass die Menschen ihre Trauer legitimieren wollen. Beispielsweise, dass sie schon seit Jahren Fan sind – und deshalb trauern dürfen. Das sagt sehr viel über unsere Vorstellung aus, unter welchen Umständen man überhaupt das Recht hat zu trauern. Da gibt es Normen in unserer Gesellschaft. Wenn jemand Nahestehendes stirbt, dann wird erwartet, dass wir traurig sind. Beim Onkel dritten Grades ist das nicht ganz so zwingend und beim Arbeitskollegen ist es nochmals anders. Die Vorstellung, wann man wie stark trauern darf, ist in den Köpfen drin.
Und dann gibt es noch die Trauer über ein Ereignis. Welche Mechanismen spielen da?
Das erste Ereignis, das im Internet in grossem Stil betrauert wurde, war wohl Charlie Hebdo, der Anschlag 2015 auf die Redaktion der Pariser Satirezeitung. In solchen Fällen geht es meiner Ansicht nach nicht nur um Trauer, sondern auch um Angst. Angst, dass so etwas möglich ist, Angst, dass einem selbst auch so etwas passieren könnte. Im Grunde kann man aber Ähnliches beobachten wie bei der Fan-Trauerkommunikation, also dass sich ganz viele Leute auf den verschiedensten Plattformen äussern. Oftmals sind die Äusserungen musterhaft und ähnlich. So etwa wie RIP, «rest in pace». Oder bei Charlie Hebdo «Je suis charlie». Das ist übrigens ein schönes Beispiel für eine sprachliche Formel, die aus einem konkreten Ereignis hervorging. Beim Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Deutschland hiess es dann «Ich bin Berlin». Und es folgten bei weiteren Ereignissen viele «Ich bin …». Auf der emotionalen Ebene hat diese Art von Trauer die Facette der Solidarität mit den Opfern und den Hinterbliebenen. Wieder ist dieses vernetzende Momentum im Zentrum. Man ist nicht allein mit dieser Angst, mit dieser Trauer.
Viele Tweets beinhalten religiöse Anspielungen, etwa betende Hände, ein Emoji mit Heiligenschein, ein Kreuz. Welche Rolle spielt in dieser digitalen Welt die Religion tatsächlich?
Ich glaube, sie spielt schon eine Rolle. Die Religion ist in unserer westlichen Welt fest verankert als Sinnangebot bei todesbezogenen Verlusterfahrungen. Das hat sich eingeprägt, und sich ganz davon zu lösen, fällt vielen schwer. Auch wenn sie im Alltag gar nicht religiös aktiv sind. Die verwendeten religiösen Symbole oder beispielsweise das RIP sind zwar verblasst in in ihrer religiösen Bedeutung, aber sie bieten einen tröstlichen, bekannten Rahmen und geben irgendwie Sicherheit. Um das kurz zu illustrieren: Vor zwei Wochen ist in meiner Familie jemand gestorben und wir haben keine Beerdigung gemacht, sondern einfach die Asche verstreut. Das ist etwas, wozu man sich noch immer ganz bewusst entscheiden muss, wenn man das will. Und so ein Entscheid löst auch heute noch kritische Stimmen aus. Das zeigt, dass der Tod noch immer mit tief verankerten religiösen Ritualen verknüpft ist. Auf den Sozialen Medien ist dies zwar nur auf einer abstrakten Ebene erkennbar, aber ganz loslösen kann man den religiösen Aspekt nicht.
Mit digitalen Trauerbekundungen werden auch sensible Daten aufs Internet geladen, wie etwa Bilder des Verstorbenen. Oder die persönliche Leidensgeschichte wird öffentlich gemacht, ohne dass der Betroffene seine Einwilligung gegeben hat. Müssten da rechtliche Schranken gesetzt werden?
Das ist eine wichtige und gleichzeitig schwierige Frage. Ich habe kürzlich zusammen mit einer Kollegin ein Heft zum Thema (Online-)Trauerpraktiken herausgegeben, worin sich auch ein Jurist geäussert hat. Die Lage ist in vielerlei Hinsicht unklar. Es gibt kaum Leitlinien. In der Schweiz ist es so, dass das Persönlichkeitsrecht mit dem Tod erlischt. Erstmal ist also eine digitale Verarbeitung einer ganz persönlichen Lebens- und Sterbegeschichte nichts Illegales. Ethisch gesehen ist das aber eine andere Sache. Man muss sich fragen, ob das, was im Internet publiziert wird, im Sinne der Verstorbenen ist. Vielleicht steht heute aber das Bedürfnis des Trauernden vermehrt im Vordergrund und nicht mehr die Wünsche des Verstorbenen.
Gibt es Massnahmen, die jeder von uns bereits zu Lebzeiten ergreifen kann?
Man muss sehr deutlich äussern, was man sich wünscht. Es gibt beispielsweise eine so genannte «Postmortale Vollmacht». Darin kann man unter anderem festlegen, was mit den eigenen Profilen in den Sozialen Netzwerken geschehen soll. Und es gibt offenbar auch die Möglichkeit, den Hinterbliebenen Auflagen zu machen, was sie tun dürfen mit dem Digitalen Nachlass und was nicht. Laut Rechtsexperten ist das Verfassen einer solchen Auflage aber äusserst komplex und nicht einfach umzusetzen. Am besten ist es deshalb erstmal, seine Wünsche den Angehörigen ganz deutlich mitzuteilen – und darauf zu hoffen, dass sie dann auch so umgesetzt werden.
Schauen wir in die Zukunft. Künstliche Intelligenz ist in aller Munde. Bereits werden Verstorbene virtuell wieder zum Leben erweckt.
Bis zu einem gewissen Grad kann es vielleicht helfen, Dinge abzuschliessen. Die Frage ist, ob das auf die Zeit hinaus sinnvoll ist, um den Trauerprozess voranzubringen. In unseren Untersuchungen zeigte sich ein riesiges Bedürfnis, den «Dialog» mit dem Verstorbenen aufrechtzuerhalten. Sowohl in den Sozialen Medien als auch auf den Gedenkseiten werden die Verstorbenen immer wieder direkt angesprochen. Es werden Briefe an die Verstorbenen geschrieben und eigene Alltagssorgen erzählt. Die künstlichen Plattformen gaukeln einem vor, dass man weiterhin mit der verstorbenen Liebsten sprechen kann – auch wenn man keine Antwort bekommt. Das normale Leben wieder aufzunehmen wird, wenn dieser Zustand länger dauert, schwierig. Vielleicht kennen Sie die britisches Netflix-Serie «black mirror» In einer Episode stirbt der Partner und die Hinterbliebene bekommt Mails und Telefonanrufe aufgrund der vielen Daten, die er im Netz hinterlassen hat. Und irgendwann wird dann ein Roboter geliefert, der so spricht und aussieht wie der Verstorbene. Die Geschichte geht nicht gut aus …
Wird sich KI im Trauerprozess trotzdem etablieren?
Ich weiss es nicht, wie in vielen Bereichen hat KI Potential und Gefahren – auch wenn es um Trauer geht. Wir können uns vor KI zwar nicht verschliessen, aber die Frage ist, wie wir mit ihr umgehen. Wollen wir wirklich alle mit Hologrammen sprechen? Alltagstauglich wird das vermutlich erstmal nicht sein.
palliative zh+sh / Bettina Weissenbrunner